Es gibt Themen, über die ich stundenlang sprechen oder schreiben könnte. Sie sind spannend, laden ein, neue Perspektiven zu erkunden und den eigenen Horizont zu erweitern.
Und dann gibt es Themen, die mich irritieren. Weil sie so selbstverständlich übernommen werden, ohne dass wir ihre Bedeutung und Folgen hinterfragen. Das Thema „Mobbing unter Katzen“ gehört dazu. Es ist weit verbreitet – sogar unter KollegInnen – und doch so fern von der Realität. Der Begriff „Mobbing“, wie wir ihn heute verstehen, ist ethologisch nicht mehr haltbar und führt auch moralisch zu ernsthaften Problemen.
Vielleicht hast Du es auch schon gesagt oder gedacht: „Meine Katze mobbt die andere.“ Er klingt vertraut, greifbar – und doch führt er in die Irre. Denn das, was wir „Mobbing“ nennen, ist in Wahrheit etwas ganz anderes.
Warum dieser Begriff so trügerisch ist und ein verzerrtes Bild vom Zusammenleben Deiner Katzen erzeugt und wie Du stattdessen einen klareren Blick auf das Verhalten Deiner Katzen gewinnen kannst, schauen wir uns in diesem Artikel an. Es wird ein wenig theoretisch, aber es lohnt sich, um hinterher klarer zu sehen.
Mein Ziel: Dir die Sicherheit zurückzugeben, das Verhalten Deiner Katzen nicht durch eine menschliche Brille zu deuten, sondern wirklich zu verstehen – und ihnen dadurch mit Respekt und Verantwortung zu begegnen.
Was wir „Mobbing“ nennen – und warum das problematisch ist
Wenn Katzenhalter:innen sagen:
„Meine Katze wird gemobbt“, klingt das sofort vertraut. Wir verstehen, was gemeint ist: eine einseitige Schikane, bei der eine Katze scheinbar Opfer ist und eine andere die Täterrolle übernimmt. Der Begriff ist emotional griffig – und genau das macht ihn so verführerisch.
Doch hier liegt die Schwierigkeit:
„Mobbing“ ist ursprünglich ein menschlicher Begriff. In den Sozialwissenschaften und der Psychologie seit den 1970er-Jahren beschreibt „Mobbing“ bewusstes, systematisches Schikanieren mit Absicht und Schuldzuweisung. Es geht hier v. a. um moralische Kategorien: jemand handelt „böse“ oder „falsch“, jemand anderes ist „unschuldig“ betroffen.
Übertragen wir diese Definition auf unsere Katzen, entsteht ein problematisches Bild. Denn Katzen handeln nicht aus Bosheit. Sie denken nicht in Kategorien wie Schuld oder Gerechtigkeit. Ihr Verhalten folgt funktionalen Gründen: Stressabbau, Verteidigung von Ressourcen, Unsicherheit oder schlicht dem Bedürfnis nach Abstand.
Woher stammt das Wort „Mobbing“?
Interessanterweise stammt das Wort „mobbing“ ursprünglich tatsächlich aus der Tierwelt.
- Im Englischen bedeutet to mob: „sich in einer Gruppe gegen jemanden richten“.
- In der Ethologie wurde damit beschrieben, dass mehrere Vögel gemeinsam einen Greifvogel attackieren.
→ Ziel: rein funktional – ein Überlebensmechanismus, ohne moralische Wertung. - In der Übertragung auf den Menschen erhielt „Mobbing“ jedoch eine neue Bedeutung: soziale Ausgrenzung, systematische Erniedrigung, psychische Gewalt. Hier kommt die ethische Dimension ins Spiel – und damit auch die Schwere und Verwerflichkeit des Handelns.
Worte schaffen Wirklichkeit
Sprache ist nie neutral. Wie nutzen sie bewusst, um unser Innenleben, unser Verständnis von der Welt anderen mitzuteilen. Dadurch sind Worte keine Etiketten – Worte schaffen Wirklichkeit. Begriffe wie ‚mobben‘ oder ‚ärgern‘ erzeugen falsche Bilder in unseren Vorstellungen und beeinflussen, wie wir handeln.
Wenn Du heute sagst: „Meine Katze wird gemobbt“, meinst Du vermutlich, dass sie unter einseitigen, wiederkehrenden Spannungen leidet. Doch unbewusst transportierst Du dabei den menschlichen Bedeutungsgehalt mit: Täter und Opfer, Schuld und Unschuld, gut und böse.
Sprache ist nie neutral. Worte schaffen Wirklichkeit.
Wenn Du dagegen von „Spannungen“, „einseitigen Konflikten“, „Konflikten aufgrund von Mangel an Ressourcen“ oder „belastenden Interaktionen“ sprichst, beschreibst Du das Verhalten sachlicher. Diese Begriffe nehmen die Schuldzuweisung heraus und öffnen den Raum für eine respektvolle, lösungsorientierte Sicht.
Indem Du Deine Sprache veränderst, veränderst Du auch Deine Wahrnehmung – und damit den Umgang mit Deinen Katzen. Du bekommst die Möglichkeit, handlungsfähig zu werden, ohne in die Falle von Schuldzuweisungen zu tappen.
Warum Katzen keine Mobber sind – sondern gestresste Tiere
Katzen besitzen kein moralisches Bewusstsein. Anders als Menschen handeln sie nicht aus „Bosheit“ oder mit der Absicht, andere zu demütigen oder zu schaden. Wenn Minka ihre Mitkatze Luna vom Schlafplatz vertreibt oder ihr Futter wegnimmt, ist das kein Zeichen von „fiesem Charakter“ – es ist funktionales Verhalten.
- Funktional heißt: Jede Handlung dient einem Zweck – Ressourcen sichern, Sicherheit erhöhen oder Stress abbauen.
- Das Verhalten ist situativ und abhängig von der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen der Katze.
Was bedeutet das für uns?
Wenn wir Worte wie „mobben“ oder „ärgern“ verwenden, übertragen wir menschliche Kategorien auf ein Tier. Wir sehen Schuld, Bosheit oder Gerechtigkeit – und riskieren, die Verantwortung auf die Katze zu verlagern.
Dabei liegt sie klar bei uns Menschen: Wir sind es, die Rahmenbedingungen schaffen und für das Wohlbefinden unserer Katzen sorgen sollten.
Ein Beispiel
Wenn Minka regelmäßig Luna vom Lieblingsplatz vertreibt, interpretiere das Verhalten nicht moralisch. Frage Dich stattdessen:
- Gibt es genug Rückzugsmöglichkeiten?
- Ist der Platz besonders begehrt oder unsicher?
- Benötigt Minka mehr Raum oder zusätzliche Ressourcen, um Stress abzubauen?
Wenn Du einer Katze unterstellst, sie mobbt, überträgst Du menschliche Kategorien auf ein Tier – und das kann großen Schaden anrichten.
Das eigentliche Problem: Ressourcenmangel
Hinter dem, was oft als „Mobbing“ bezeichnet wird, steckt in der Regel ein ganz anderes Problem: ein Ungleichgewicht in der Lebenswelt Deiner Katzen. Konflikte entstehen selten, weil eine Katze „böse“ ist. Vielmehr fehlt es an den passenden Rahmenbedingungen, die es allen ermöglichen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Typische Ursachen für Spannungen
- Rückzugsorte und sichere Plätze: Nicht jede Katze hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen oder einen ungestörten Rückzugsort zu erreichen. Wer keinen sicheren Platz hat, wird schneller gestresst.
- Toiletten, Futter- und Wasserplätze: Zu wenige Ressourcen erzeugen Konkurrenz und Spannung. Katzen sind territorial. Um ihren Wohnraum zu teilen, benötigen sie Ressourcen im Überfluss.
- Ungleiche Auslastung: Unterschiedliche Aktivitätsbedürfnisse oder Energielevel (z. B. Kater vs. Kätzin, Jungtier vs. Adult) führen zu Frustration. Eine Katze möchte spielen, die andere Ruhe – schon entsteht Spannung.
- Schmerz, Krankheit oder Unsicherheit: Schmerzen oder gesundheitliche Einschränkungen verändern Verhalten, verstärken Dominanz, Rückzug oder Unsicherheit.
- Gruppenzusammenstellung: Alter, Geschlecht, Kastration und die soziale Verträglichkeit beeinflussen die Dynamik innerhalb des Katzenrudels.
Nicht nur Futter, Wasser oder Rückzugsorte zählen zu den Ressourcen, die eine Katze braucht. Auch soziale Kontakte, mentale Beschäftigung, Spiel und Gesundheit sind entscheidend. Fehlen diese, kann das zu Frustration, Langeweile oder sogar depressiv wirkenden Rückzugsmustern führen. Jede Katze reagiert dabei individuell und die Kernemotionen FEAR (Angst), RAGE (Wut) und GRIEF (Kummer) werden aktiviert. Daraus entsteht funktionales Verhalten, das wir als Konflikt wahrnehmen.
Neurowissenschaftlicher Blick
Stress aktiviert bei Katzen wie bei uns Menschen die sogenannten Basisemotionen:
- FEAR (Angst)
- RAGE (Wut)
- GRIEF (Kummer)
Diese Emotionen lösen funktionales Verhalten aus – etwa Verteidigung, Rückzug oder Durchsetzungsverhalten – das wir als „Konflikt“ wahrnehmen.
Ein Beispiel
Wenn Minka ständig Luna vom Lieblingsplatz vertreibt, ist das kein Zeichen von Bosheit. Vielmehr zeigt Minka damit, dass sie einen sicheren, stressfreien Rückzugsort benötigt. Vielleicht ist der Platz besonders begehrt oder Minka braucht einfach mehr Raum, um Stress abzubauen. Katzen legen viel Wert auf ihre Rückzugsorte.
Missverständnisse entstehen, weil wir das Verhalten unserer Katzen durch unsere menschliche Brille betrachten und soziale Kategorien wie „Mobbing“ auf unsere felinen Schützlinge übertragen. Dabei übersehen wir, dass Katzen nach ihren eigenen Regeln leben – Regeln, die wir als KatzenhalterInnen und Katzeneltern verstehen lernen müssen.
Eine Katze, die im Mangel lebt, kann nicht teilen – auch keine Wohnung.
Warum der Begriff „Mobbing“ sogar gefährlich ist
Wenn Du den Begriff „Mobbing“ auf Deine Katzen anwendest, kann das Schaden anrichten – und zwar nicht durch das Verhalten Deiner Katze, sondern durch die Art, wie Du es wahrnimmst. Am Ende wirkt sich Deine Wahrnehmung auf eure Beziehung zueinander und auf die Beziehung Deiner Katzen untereinander aus.
Schaden durch falsche Sprache
- Du verlagerst Verantwortung auf Deine Katze.
- Normales Konfliktverhalten wird fehlinterpretiert.
- Du riskierst, der „Täter-Katze“ zu misstrauen, sie zu strafen, wegzusperren oder sogar abzugeben.
- Du riskierst, die „Opfer-Katze“ zu bevorzugen und verschärfst dadurch den Konflikt.
- Die eigentlichen Ursachen wie Stress oder Ressourcenmangel bleiben unsichtbar.
Im Klartext heißt das: Nicht die Katze ist das Problem und es gibt auch keine TäterInnen oder Opfer. Die Situation ist unglücklich für Deine Katzen und sie zeigen es durch ihr Verhalten – mal aktiv, mal passiv. Wenn Du glaubst, Deine aktive Katze ist einfach gemein – ändert sich nichts. Wenn Du erkennst, dass sie überfordert ist, kannst Du handeln.
Aber Achtung: Auch scheinbare Passivität kann ein subtil aktives Verhalten sein. Katzen setzen sich in den Weg, fixieren, signalisieren Unbehagen oder beeinflussen die Situation, ohne laut oder aggressiv zu werden. Als KatzenhalterInnen und Katzeneltern gilt es, diese Signale zu erkennen und die dahinterliegenden Bedürfnisse zu verstehen.
Die Umkehrung der Verantwortung
Wenn Du einer Katze moralisches Denken zuschreibst, erwartest Du gleichzeitig, dass sie sich entsprechend verhält.
Das ist ein klassischer Mechanismus der Verlagerung von Verantwortung:
- Du siehst Dich nicht mehr als Gestalter der Situation.
- Sondern erwartest Verhaltensanpassung von Deinem Tier.
Das ist nicht nur unethisch, sondern auch gefährlich, weil:
- Die Ursache des Problems verschleiert bleibt (z. B. Ressourcenmangel).
- Die aggressive Katze als „böse“ abgestempelt wird.
- Die unterlegene Katze nicht geschützt wird.
In der Folge bleibst Du passiv, obwohl nur Du die strukturellen Ursachen beheben kannst.
Ist der Begriff „Mobbing“ noch brauchbar?
Streng genommen: nein.
Für die Ethologie wäre er nur in der ursprünglichen, funktionalen Bedeutung korrekt. Für die Beratungspraxis ist er problematisch, weil Menschen sofort an die ethische Dimension denken – und dadurch ihre Katze moralisch bewerten (als „Täter“ oder „Opfer“). Das verstellt den Blick auf Ursachen und Lösungen und blockiert Deine Handlungsfähigkeit.
Anzeichen für Konflikte unter Katzen (ehemals „Mobbing“)
Konflikte unter Katzen zeigen sich oft subtil – und werden leicht fehlinterpretiert. Es geht dabei niemals um „Gemeinheit“ oder „bösen Charakter“, sondern um Stressregulation und die Reaktion auf eine belastende Situation.
Typische Beobachtungen:
- Starren, Blockieren, Schlafplatzbesetzung: Wenn eine Katze eine andere konsequent vom Lieblingsplatz fernhält oder sich ihr in den Weg stellt, ist das Ausdruck von Unsicherheit, Frustration, Langeweile oder Territorialverhalten.
- „Vom-Platz-putzen“: Katzen, die andere regelmäßig vom Futterplatz oder Lieblingsplatz vertreiben, handeln funktional – sie sichern Ressourcen oder suchen Sicherheit, weil sie selbst verunsichert sind.
- Rückzug, Futterverweigerung: Ziehen sich Katzen zurück oder verweigern zeitweise das Fressen, kann dies ein Zeichen sein, dass sie sich überfordert oder bedroht fühlen.
- Vermeidungsverhalten und Unsauberkeit: Vermeidungsverhalten kann sich in Ausweichbewegungen, Flüchten oder sogar in Unsauberkeit äußern. Letzteres ist keine „Rache“ oder „Protest“, sondern Ausdruck von Unsicherheit, Anspannung, Krankheit oder Frustration.
- Übermäßige Fellpflege: Übermäßiges Putzen kann ein Mechanismus zur Stressbewältigung sein – eine Art Selbstregulation, um Angst, Unsicherheit oder Spannung abzubauen.
- Erlernte Hilflosigkeit: Zeigt eine Katze dauerhaft resigniertes Verhalten, kann dies auf eine chronische Überforderung hinweisen, bei der sie keine wirksame Strategie mehr sieht, um mit herausfordernden Situationen umzugehen.
Praxisbeispiele (Infobox):
- Felix sitzt regelmäßig vor der Katzentoilette, blockiert sie oder nutzt sie nicht. Dies ist selten ein „böses Verhalten“ – meist signalisiert es Unsicherheit, Angst oder Frustration.
- Tom frisst nicht, solange Tiger in der Nähe ist. Auch hier gilt: kein böses Motiv, sondern ein funktionaler Mechanismus, um Stress zu vermeiden.
Beachte auch subtile Zeichen wie reduzierte soziale Interaktion, scheinbare Trägheit, Langeweile oder anhaltende Zurückgezogenheit. Diese sind funktionale Reaktionen auf fehlende mentale oder soziale Ressourcen.
Wenn Du diese Signale erkennst, kannst Du die Situation verstehen, ohne moralische Kategorien anzulegen. Es geht darum, die Bedürfnisse jeder Katze wahrzunehmen, die Rahmenbedingungen anzupassen und Stress aktiv zu reduzieren, statt die Verantwortung fälschlicherweise der Katze zuzuschreiben.
Mit diesem Gedanken geht es jetzt darum, nicht nur hinzuschauen, sondern aktiv Verantwortung zu übernehmen.“
Was Deine Verantwortung ist – und wie Du wirklich helfen kannst
Katzen sind abhängige, sensible Wesen – keine Mini-Menschen. Deshalb liegt die Verantwortung für ein stressfreies Zusammenleben eindeutig bei Dir. Du gestaltest die Haltung, die Ressourcenausstattung, die Gruppenstruktur und sorgst für den Schutz aller Beteiligten.
Nur Menschen besitzen moralisches Denken – und damit die Fähigkeit, Verantwortung bewusst zu übernehmen. Neutralität oder Abwarten reicht nicht aus. Wenn Du erkennst, dass Deine Katze gestresst ist, bist Du es, der die Rahmenbedingungen verändern muss, nicht die Katze, die sich anpassen sollte.
Wir müssen also weg von dem Gedanken „die Katze muss sich anpassen“, hin zu: „Ich gestalte die Umgebung so, dass koexistierendes Verhalten möglich wird.“
Abwarten bringt nichts – handeln schon. Die Verantwortung für die Lebensbedingungen Deiner Katzen zu übernehmen, ist der Schlüssel, um Stress, Konflikte und ungewolltes Verhalten nachhaltig zu reduzieren.
Konkrete Handlungsschritte
- Ressourcenmanagement: Sorge dafür, dass es mindestens eine Ressource mehr gibt als Katzen – also Toiletten, Futterplätze, Wasserstellen und Rückzugsorte.
- Rückzugsräume separat zugänglich machen: Nutze Chipklappen oder getrennte Zimmer, damit jede Katze sicheren Rückzug findet; mindestens ein Raum mehr als Katzen.
- Beschäftigung: Biete individuelle und gemeinsame Spiele, Clickertraining oder Suchspiele an – ohne Zwang, mit positiver Verstärkung.
- Tierarzt-Check: Lass alle Katzen regelmäßig untersuchen, um Schmerzen, Krankheiten oder Einschränkungen auszuschließen.
- Home-Check-Up: Führe mindestens einmal pro Woche kleine Check-Ups durch, um Fell, Schleimhäute, Gewicht etc. zu kontrollieren.
- Verhalten beobachten & dokumentieren: Notiere, wann welche Konflikte auftreten und welche Katze betroffen ist. So erkennst Du Muster und Auslöser besser.
- Frühzeitig professionelle Beratung holen: Katzenberater:innen, Tierpsycholog:innen oder Trainer:innen können wertvolle Unterstützung geben, bevor Konflikte sich verfestigen.
- Verantwortungsübernahme bewusst leben: Erkenne, dass Katzen kein moralisches Bewusstsein besitzen – die Verantwortung für ein stressfreies Zusammenleben liegt bei Dir.
Checkliste: So übernimmst Du Verantwortung für das Wohl Deiner Katzen
- Beobachte genau
- Achte auf Anzeichen von Stress: Blockieren, Starren, Schlafplatzbesetzung, Futterverweigerung, Rückzug, übermäßige Fellpflege oder Unsauberkeit.
- Notiere, in welchen Situationen die Reaktionen auftreten und welche Katze betroffen ist.
- Analysiere die Rahmenbedingungen
- Gibt es für jede Katze ausreichend Rückzugsorte und sichere Plätze?
- Sind Futterplätze, Wasserstellen und Katzentoiletten in ausreichender Anzahl und sinnvoll verteilt?
- Sind Altersunterschiede, Aktivitätslevel, Kastrationsstatus oder gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigt?
- Erkenne funktionale Ursachen
- Jede Handlung Deiner Katzen ist funktional: Ressourcen sichern, Stress abbauen, Sicherheit erhöhen, Energie abbauen etc.
- Prüfe, ob Konflikte durch Mangel an Ressourcen, unzureichende Rückzugsmöglichkeiten oder unterschiedliche Bedürfnisse entstehen.
- Verantwortung beim Menschen erkennen
- Deine Katzen besitzen kein moralisches Bewusstsein – die Verantwortung liegt bei Dir.
- Vermeide Schuldzuweisungen an Deine Katzen. Dein Handeln gestaltet die Situation.
- Rahmenbedingungen gezielt verbessern
- Schaffe zusätzliche Rückzugsorte, sichere Beobachtungspunkte und ausreichend Ressourcen, um Konflikte zu entschärfen.
- Passe Gruppenzusammenstellung, Beschäftigungsmöglichkeiten und Tagesabläufe an die individuellen Bedürfnisse der Katzen an.
- Verhalten respektvoll lenken
- Reagiere sachlich auf Konfliktsituationen: Vermeide Strafen oder Zwang, setze auf Struktur, sichere Ressourcen und positive Verstärkung.
- Unterstütze die Katzen darin, Stress abzubauen und sich sicher zu fühlen.
- Handeln statt abwarten
- Beobachte, reflektiere, verbessere die Rahmenbedingungen – nur so können Konflikte langfristig gelöst werden.
- Denke immer:
Wenn Du erkennst, dass Deine Katze gestresst ist, liegt die Verantwortung bei Dir. Du kannst die Rahmenbedingungen ändern – nicht die Katze.
Zeit für einen neuen Blick auf Katzenverhalten
Wenn Du verstehst, dass „Mobbing“ ein wertender Begriff aus unserer menschlichen Welt ist, der unseren Katzen nicht gerecht wird, kannst Du vielleicht nachvollziehen, warum es mich triggert, dass dieser Begriff unreflektiert immer wieder herangezogen wird, um das Konfliktverhalten unserer Katzen zu benennen.
Ich plädiere daher dafür, dass wir aufhören, in Schuld und Drama oder Opfer und TäterIn zu denken – es hilft weder Dir noch Deinen Katzen, sondern schadet euch beiden. Stattdessen können wir neutrale, wertfreie Begriffe wie ‚einseitige Konflikte‘, ‚Spannungen unter Katzen‘ oder ‚Konflikte aufgrund von Ressourcenmangel‘ nutzen. So bleibt Dein Blick sachlich, lösungsorientiert und respektvoll.
Jede Katze handelt funktional. Das bedeutet nicht, dass sie ein Roboter ist, aber ihr Verhalten dient einem bestimmten Zweck: Stressabbau, Ressourcen sichern, Sicherheit erhöhen etc. Nur ist dieser Zweck bei unseren Katzen völlig wertfrei und rein auf ihr Überleben ausgerichtet.
Wenn Du die Rahmenbedingungen richtig gestaltest, minimierst Du Konfliktpotenzial in Deinem Rudel und euer Zusammenleben wird dadurch deutlich harmonischer.
Übernimm Verantwortung – und zwar mit Respekt und Wertschätzung. Deine Katzen sind keine kleinen Diven, die ‚bestraft‘ werden müssen, sondern sensible Schutzbefohlene, deren Wohlbefinden in Deiner Hand liegt.
Katzen machen es nicht schwer – wir machen es ihnen schwer. Aber wir können es besser machen.
Fragst Du Dich manchmal, ob Deine Katzen sich wirklich wohlfühlen – oder ob unterschwellige Spannungen Euren Alltag belasten?
In einer persönlichen Beratung helfe ich Dir, das Verhalten Deiner Familienkatzen klarer zu verstehen und unterstütze Dich, passende Lösungen für ein harmonisches Zusammenleben zu entwickeln.



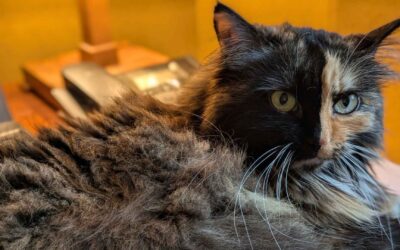

0 Kommentare
Trackbacks/Pingbacks