Erfolgreiches Training (Teil 2): Lernprinzipien im Überblick

Überblick| In diesem Beitrag erhältst Du einen Überblick über die verschiedenen Prinzipien, die Lernen zugrunde liegen bzw. deren Auswirkungen auf das Verhalten und das Wohlbefinden unserer Katzen. Trainingsmethoden, die auf Positiver Verstärkung beruhen, sind die respektvollsten und effektivsten Methoden, da sie das Vertrauen und die Bindung zwischen Mensch und Katze stärkt und Kreativität sowie Selbstvertrauen fördert. Training, das auf Negativer Verstärkung basiert, kann in speziellen Situationen nützlich sein, aber nur in Verbindung mit positiven Verstärkungen, um die Katze nicht in ihrer sozialen Bindung und ihrem Vertrauen zu beeinträchtigen. Es gibt aber auch Trainingsmethoden, die mit Strafen arbeiten. Die dahinter stehenden Prinzipien führen zu Angst, Aggression und Vertrauensverlust, weshalb sie im Umgang mit Katzen oder im Katzen-Training vermieden werden müssen. Eine respektvolle, belohnungsbasierte Herangehensweise ist der Weg der Wahl zu einem harmonischen Zusammenleben und einem erfolgreichen Training.
Warum das Verständnis darüber, wie wir lernen so wichtig sind
Das Training unserer Katzen ist ein zentrales Element für ein entspanntes Zusammenleben und das Wohlbefinden unserer Samtpfoten. Dabei ist es entscheidend, mit den richtigen Wirkmechanismen zu arbeiten, die nicht nur das gewünschte Verhalten fördern, sondern auch die Beziehung zwischen uns und unserer Katze stärken. Und das macht es so wichtig, sich zumindest ein Mal mit den Auswirkungen der verschiedenen Prinzipien, die Lernen zugrunde liegen, auseinanderzusetzen. Die Wahl der richtigen Wirkung hängt maßgeblich davon ab, wie wir als Katzeneltern unsere Katze verstehen und wie wir ihre Bedürfnisse respektieren.
Es gibt verschiedene Ansätze, um das Verhalten einer Katze zu beeinflussen – von der Positiven Verstärkung bis hin zu Negativer Verstärkung oder Bestrafungen. Wir möchten uns zunächst auf das respektvollste Lernprinzip konzentrieren, die Positive Verstärkung, anschließend werfen wir einen Blick auf die weniger bzw. nicht empfohlenen Prinzipien wie Negative Verstärkung und Straftechniken, um den Unterschied zur Positiven Verstärkung zu verdeutlichen.
Die vier Lernprinzipien im Überblick
Positive Verstärkung (R+)
Positive Verstärkung ist eine der beliebtesten und effektivsten Prinzipien im Katzen-Training- vorausgesetzt, dass man Wert legt auf eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe. Das Prinzip basiert darauf, das gewünschte Verhalten einer Katze zu fördern, indem wir ihr etwas Angenehmes anbieten, sobald sie dieses Verhalten zeigt.
Was ist Positive Verstärkung?
Positive Verstärkung bedeutet, dass wir ein Verhalten belohnen, sobald es auftritt. Diese Belohnung kann z.B. in Form von Leckerlis, Streicheleinheiten, Spiel oder Lob erfolgen. Der Schlüssel dabei ist, dass unsere Katze die Belohnung als solche bewertet und unmittelbar nach dem gewünschten Verhalten erhält, damit sie die Verbindung zwischen der Handlung und der Belohnung verstehen kann. Das stärkt ihre Motivation, dieses Verhalten zu wiederholen. dahinter steckt das Lernen aufgrund angenehmer Erfahrungen.
Vorteile der Positiven Verstärkung
Die Vorteile dieses Lernprinzips sind vielfältig:
- Fördert Vertrauen und Zusammenarbeit: Da Positive Verstärkung auf angenehmen Folgen für bzw. auf ein Verhalten basiert, stärkt sie das Vertrauen zwischen uns und unserer Katze. Unsere Katze erhält auf ihr Verhalten positives Feedback und lernt, dass der Mensch eine Quelle von schöner Erfahrung ist.
- Baut Stress ab: Positive Verstärkung ist i.d.R. frei von negativem Beigeschmack und fördert eine entspannte Lernumgebung. Unsere Katze muss keine Angst vor Bestrafung oder negativen Erfahrungen haben.
- Stärkt die Bindung: Die Belohnung durch Spiel, Lob oder Streicheleinheiten stärkt die emotionale Bindung zwischen unserer Katze und uns. Die angenehme Folge (aka Belohnung) auf ihr Verhalten zeigt, dass wir das Verhalten unserer Katze schätzen.
- Langfristige Wirkung: Katzen, die mit Positiver Verstärkung gehandelt und trainiert werden, entwickeln nicht nur ein besseres Verständnis für die gewünschten Verhaltensweisen, sondern sind auch motivierter, in Zukunft weiterhin mit dem Menschen zusammenzuarbeiten.
- Fördert Kreativität: Unsere Katzen sind von Natur aus neugierig und erlernen neue Verhaltensweisen am besten, wenn sie in einem sicheren und wertschätzenden Umfeld selbstständig ausprobieren können, was funktioniert. Auf diese Weise werden sie stets zu neuen Verhaltensweisen, aber auch zu selbstständigen Entscheidungen angeregt.
- Fördert Selbstvertrauen: Wenn ihre Neugier mit einem angenehmen Ereignis beantwortet wird, entsteht ein Positiv-Kreislauf, der unsere Katzen dazu ermutigt, stets weitere Erfahrungen zu sammeln und noch mutiger zu werden und Neues auszuprobieren. Hier stimmt der Satz voll und ganz: Mut kommt durch (angenehme) Erfahrungen.
Nachteile der Positiven Verstärkung
Es wäre schön zu schreiben, dass dieses Lernprinzip frei von Nachteilen sei… Aber weitestgehend stimmt es: Stets bejahende Rückmeldung zu erhalten, reduziert Nachteile auf ein Minimum. Dennoch gibt es evtl. einen Nachteil, der v. a. Deiner Bewertung und Prioritäten unterliegt:
- Forderung nach mehr: Katzen, die aktiv gefördert werden, beginnen, aktiv zu fordern: D.h., dass Deine Katze sich auf Dich verlässt, dass Du täglich exklusiv Zeit mit ihr verbringst und kann bei Langeweile ihre Intelligenz, Kreativität und Erwartungshaltung auch zu Unsinn einsetzen und z.B. Schubläden ausräumen, Schränke öffnen, sich selbst Futter suchen oder zärgeln etc. Wenn Du Dir dessen bewusst bist, dass Deine Katze ein komplexes, intelligentes und anspruchsvolles Lebewesen ist, dann lege Deine Prioritäten so, dass Du ihren Bedürfnissen gerecht wirst. Ihr führt eine Freundschaft auf Lebenszeit, in der Du die Verantwortung für euer Wohl trägst.
Beispiel aus dem Alltag
Nehmen wir an, unsere Katze springt immer wieder in einen bestimmten Karton. Wir können dieses Verhalten nutzen und mit einem Spiel belohnen. Dadurch kommunizieren wir klar: „Wenn Du in den Karton springst, spielen wir.“ So bauen wir den Platz in dem Karton zugleich als leicht verständliches Signal für den Spielwunsch unserer Katze auf. Sie lernt, dass der Karton ein Signal an uns ist, dass sie einsetzen kann, um uns zu sagen, dass sie spielen möchte. Und wir erkennen ihr Verhalten als ihren Spielwunsch und können ihr Bedürfnis entsprechend stillen.
Achtung: Wenn Du mal keine Zeit für ein Spiel hast, solltest Du Deiner Katze eine alternative Beschäftigung wie z.B. ein Futterspiel anbieten. So verhinderst Du, dass der Karton als Startsignal fürs Spiel nicht an Bedeutung verliert und vermeidest Frust bei Deiner Katze, weil Du ihr Bedürfnis gerade jetzt nicht stillen kannst. Aber: nutze diese Alternative nur selten, da die eigentliche Bedeutung des Kartons als ein Jagdspiel mit Dir aufgebaut wurde.
Gefühle der Katze und Auswirkungen
Die Auswirkungen dieses Lernprinzips machen die Positive Verstärkung (auch R+ abgekürzt*) so attraktiv: Unsere Katze fühlt sich durch Positive Verstärkungen sicher und geschätzt, da sie für ihr Verhalten sofortige und angenehme Reaktionen erhält. Diese Methode steigert ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation, mit uns zusammenzuarbeiten. Langfristig führt diese positive Erfahrung zu einer stärkeren Bindung und einem besseren Verständnis zwischen unserer Katze und uns.
*R+ steht für „positive Reinforcement“ = „positive Verstärkung“, das „+“ ist im mathematischen Sinne zu verstehen, analog gilt später das „-“ im mathematischen Sinne: etwas wegnehmen.
Negative Verstärkung (R-)
Obwohl negative Verstärkung oft in einem schlechten Licht gesehen wird, handelt es sich dabei nicht unbedingt um Bestrafung, sondern vielmehr um die Entfernung eines unangenehmen Reizes, um ein Verhalten zu fördern.
Was ist Negative Verstärkung?
Negative Verstärkung bedeutet, dass ein unangenehmer Reiz (z. B. ein unangenehmes Geräusch oder die Nähe des Menschen) entfernt wird, sobald unsere Katze ein gewünschtes Verhalten zeigt. Bei einer ängstlichen Katze könnte dies bedeuten, dass wir uns zurückziehen und den physischen Abstand zu ihr vergrößern, wenn sie z.B. sitzen bleibt statt zu fliehen. Damit verschaffen wir ihr ein Gefühl der Erleichterung.
Vorteile der Negativen Verstärkung
- Nützlich bei Angstkatzen: Bei ängstlichen Katzen können wir als Menschen der unangenehme Reiz sein. Wenn die Katze beispielsweise mit einem Blickkontakt oder einer Annäherung unser Verhalten als unangenehm empfindet, könnten wir uns zurückziehen. Diese Erleichterung schafft eine Verbindung zwischen dem Verhalten der Katze und der angenehmen Konsequenz.
- Hilft bei der Lösung von Problemen: Wir setzen übrigens die Negative Verstärkung auch in Fällen ein, in denen unsere Katze in eine missliche Lage geraten ist. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn sie sich in etwas verheddert hat, und wir ihr helfen, sich zu befreien oder wir entfernen einen Splitter aus ihrer Pfote. Ein sehr häufiges- uns aber oft nicht bewusstes Beispiel wäre außerdem, dass wir unserer Katze meist erst Futter geben, nachdem sie vor Hunger gemaunzt hat! Unsere Hilfe verschafft unserer Katze eine Erleichterung und stärkt einerseits ihr Vertrauen in uns, dass wir sie sehen, wenn sie Hilfe braucht oder sie um Hilfe bitten kann und wir zuverlässig ihr Linderung verschaffen- was wir unbedingt tun sollten! Andererseits kann es ein Abhängigkeitsgefühl verstärken, wenn unsere Katze uns zunächst um Hilfe bitten muss, bevor sie Linderung erfährt. Gerade für ängstliche oder unsichere Katzen besteht hier die Gefahr, dass sie sich hilfloser fühlen, als ohnehin schon.
Nachteile der Negativen Verstärkung
Einige Nachteile sind eben schon angeklungen. Hier erfolgt noch einmal der Überblick mit ein paar evtl. überraschenden Erweiterungen.
- Hilfslosigkeit und Selbstzweifel: Wird die Negative Verstärkung nicht mit der Positiven Verstärkung und Haltungsoptimierungen gekoppelt, sowie mit der Zeit ausgeschlichen, stellt sich über kurz oder lang ein Gefühl der Abhängigkeit zu uns ein. Diese Abhängigkeit mindert das Selbstbewusstsein und führt zu einem Gefühl der Hilf- evtl. auch Hoffnungslosigkeit. P.S.: Beim Menschen führt Hoffnungslosigkeit zu Depression..
- Frust und Vertrauensverlust: Sich nicht selbst helfen zu können, birgt für unsere unabhängige Katze Frustpotenzial- und am Ende auch Vertrauensverlust uns gegenüber. Ihr ungutes Gefühl wird sie irgendwann auf uns übertragen. Verknüpft sie ihre negativen Gefühle mit uns, dann entsteht unweigerlich eine innere Distanz zu uns und damit Vertrauensverlust.
- Geminderte Kreativität und Kooperationsbereitschaft: Wenn Du stets helfen musst, Deiner Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien, bedeutet dies auch, dass sie weniger Übung darin hat, sich selbst zu helfen. Bei Notsituationen, wie dem Splitter in der Pfote steht es außer Frage, dass unsere Katze unsere Hilfe braucht und wir eingreifen sollten. Im Falle von Futter jedoch sind Futterspiele wie Fummelbretter oder Futterparcours eine sehr gute Variante, dem Hungergefühl abzuhelfen, ohne dass unsere Katze uns bitten muss oder auf uns direkt angewiesen ist. Rechtzeitig vorbereitet, z.B. während der Schlafenszeiten, kann sich sich darauf verlassen auf ihren Streifzügen durch ihr (Wohnungs-) Revier ihrem Bedarf nach beute abzuhelfen. Eine Katze, die sich selbstbewusst und sicher fühlt, ist eher bereit, mit uns zusammenzuarbeiten.
- Mangelnde Resilienz: Ist Deine Katze stets auf Deine Hilfe angewiesen, verliert sie die Fähigkeit, ihre Probleme selbst zu lösen und damit auch Resilienz- die Widerstandskraft, um mit unangenehmen Situationen lösungsorientiert umzugehen. Sie wird zunehmend unsicher und das wiederum legt den Grundstein für unvorhergesehenes Angst- oder Aggressionsverhalten.
Daher ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Katzen sollten nie um Futter bitten müssen. Feste Fütterungszeiten in kleinen Abständen entsprechen ihrem natürlichen Wesen. Wenn sie zudem ihr Futter erarbeiten dürfen, stärkst Du nicht nur ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstständigkeit, sondern beugst zudem ein Stück weit Langeweile vor.
Gefühle Deiner Katze und Auswirkungen
Unsere Katze erlebt eine Erleichterung durch die Entfernung des unangenehmen Reizes. Dieser Prozess kann dazu beitragen, Ängste abzubauen, aber nur, wenn er in Verbindung mit positiven Verstärkungen geschieht und nicht vorrangig als Antwort auf ihre Hilferufe angewendet wird. Langfristig kann negative Verstärkung dazu führen, dass unsere Katze lernt, Situationen zu vermeiden, die sie als unangenehm empfindet, ihr Selbstbewusstsein kann sinken und sie wird mutloser oder fühlt sich hilfloser als zuvor. Dies kann sie in ihrer Fähigkeit, sich auf uns einzulassen, einschränken, wenn die positiven Aspekte nicht ebenfalls gefördert werden.
Positive Strafe (P+)
Positive Strafe bedeutet, dass ein unangenehmer Reiz hinzugefügt wird, um ein unerwünschtes Verhalten zu reduzieren. Ein Beispiel könnte das Erzeugen eines lauten Geräusches sein, wenn die Katze auf einem verbotenen Möbelstück sitzt. Dieses Verhalten mag kurzfristig zu einer Verhaltensänderung führen, jedoch wird die Katze dadurch in ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden verletzt.
Vorteile der Positiven Strafe
Der einzige Vorteil, wenn es so genannt werden sollte, ist, dass unsere Katze in dem Moment, in dem der Schreck sie trifft, tatsächlich ihr Verhalten abbricht oder unterbricht. Da der vermeintliche Erfolg sofort einsetzt, ist die Methode effektiv.
- Zeiteffizienz: Durch das unmittelbare Erleben eines Schreckens unterbricht Deine Katze sofort ihr Verhalten.
Nachteile der Positiven Strafe
Die langfristigen Folgen sind oft nicht sofort erkennbar. Abgesehen davon, dass es durchaus zu physischen Folgen kommen kann (ich habe auch schon Katzen kennengelernt, die aufgrund des Einsatzes von Strafen z.B. Knochenbrüchen, Augenschäden etc. erlitten), sind die seelischen Folgen schwerer zu erkennen und zu heilen.
- Misstrauen, Angst, Aggression gegen sich und/oder uns, Angst, in gesteigerter Form auch Aggression, extremes Meideverhalten oder Krankheiten sind nur einige der Auswirkungen.
- Krankheiten: Ein unsicheres Leben führt unweigerlich zu Krankheiten. Bewegungsmangel, mangelnde Gesundheitsvorsorge, weil Deine Katze „schwierig“ sei, Hunger und damit Nahrungs- oder Nährstoffmangel etc. sind nur einige Schritte auf der Stufe von Strafe zu Krankheit.
- Mangelnde Resilienz und Kooperation: Auch der zerstörungsarme, lösungsorientierte Umgang mit Problemen wird beeinträchtigt. Die Erwartungshaltung Deiner Katze versetzt sie in Alarmbereitschaft, so dass sie nicht offen ist für Verhalten, dass ohne Zerstörung auskommt geschweige denn auf Zusammenarbeit mit Dir. Stressfreier TA-Besuch, entspannter Alltag oder glückliche Katze-Kind-Beziehungen sind so nicht mehr möglich.
- Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit: Unvorhergesehene oder unverständliche Strafen, denen Deine Katze nicht entkommt führt zudem zu einem Gefühl der Hilflosigkeit oder Aggression. Bei sensibleren Katzen tritt vermehrt die sog. Erlernte Hilflosigkeit auf, die mit einer enormen Passivität und Selbstaufgabe einhergeht. Diese Katzen glauben nicht mehr daran, dass sie ihrem „Los“ entkommen können und vegetieren vor sich hin.
- Aggression: Katzen, die sich selbst nicht aufgegeben haben und sich ihrer noch irgendwie bewusst sind, neigen zu dem anderen Extrem: gesteigertes Aggressionsverhalten. Auch ist ein entspannter Alltag nicht mehr möglich und es besteht u.U. Lebensgefahr für andere Familienmitglieder. Aggressive Katzen werden aufgrund ihres unberechenbaren Verhaltens oft eingeschläfert oder in Tierheimen abgegeben, in denen sie dann als unvermittelbar ihr Dasein fristen müssen.
Da der Einsatz Positiver Strafe von mehreren Faktoren abhängt, die alle zusammen perfekt ablaufen und ineinander greifen müssen und zusätzlich erfordern, dass wir die innere Motivation unserer Katze für ihr Verhalten mit absoluter Gewissheit verstehen und benennen können müssen, um eine Wirkung ohne Schaden zu erzielen, rate ich absolut von dieser Methode ab! Ich sehe keinen Sinn und keine Möglichkeit für irgendeinen Menschen, die extremen Voraussetzungen von Strafe erfüllen zu können- und sehe keinen Nutzen oder „echten“ Vorteil, der den Einsatz von Strafe rechtfertigen würde. Nicht, wenn es um Vertrauen in Beziehungen geht. Im Falle von Aggressionen stellen diese i.d.R. Verhaltensantworten unserer Katze auf unser Handeln dar. M.E. stehen damit wir Katzeneltern, die wir eine Katze in unseren Haushalt aufnehmen, in der Verantwortung unser Handeln zu überdenken und eine entsprechende Entscheidung über die Art unseres Umganges mit den uns anvertrauten Seelen zu treffen.
Beispiel aus dem Alltag
Es kommt leider häufiger vor, als mir lieb ist, aber der Vollständigkeit und Aufklärung halber gebe ich Beispiele zur positiven Strafe, die mir aus meinen Beratungsfällen bekannt sind. Ein weit verbreitetes Beispiel ist, eine Katze mittels eines Wasserstrahls aus einer Sprühflasche zu bestrafen. Sie soll ihr aktuelles Tun unterbrechen und durch den Schreck, den sie erlebt, daran gehindert werden künftig ihr Verhalten zu wiederholen. Andere Beispiele sind Anstarren, Verfolgen, die Katze abduschen, anschreien, mit einem Kissen o.ä. bewerfen, aus- oder einsperren usw.
Ein Hinweis an dieser Stelle: Bei der Positiven Strafe geht es um das bewusste Zufügen eines unangenehmen Reizes. Wenn unsere Katze in unserem respekt- und liebevoll gestalteten Alltag aber etwas tut, z.B. auf die Anrichte springen, und es fällt ihr z.B. eine Küchenrolle entgegen, die sie aus ihrer Perspektive von unten nach oben nicht sehen konnte, so stellt dies ebenfalls eine Erfahrung im Sinne einer Positiven Strafe dar. Wichtig ist an dieser Stelle: Unsere Katze verknüpft Situationen anders als wir Menschen. Für sie ist derjenige, der in der Sekunde in ihrem Blickfeld erscheint, in der sie sich erschreckt und aufblickt, der Auslöser für den Schreck. Daher sollten wir Katzeneltern darauf achten, potenzielle Gefahrenquellen zu beseitigen, eine katzengerechte Einrichtung zu gestalten sowie stets die Ruhe zu bewahren.
Sollte Dir in dem Umgang Deiner Katzen untereinander oder einem anderen Familienmitglied gegenüber eine Veränderung auffallen, dann beobachte Deine Katzen bitte genau und hole Dir rechtzeitig Hilfe für eine Einschätzung. Wenn wir unsere Katzen ihre Probleme alleine lösen lassen, dann kommen meist Ergebnisse heraus, die nicht unserer Vorstellung entsprechen.
Gefühle der Katze und ihre Auswirkungen
Durch Strafen wird unsere Katze in ihrer emotionalen Sicherheit erschüttert. Sie kann unsicher werden, was zu einer zunehmenden Distanz und weniger Bereitschaft führt, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie entwickelt Ängste, kann aggressiv werden oder sich sogar in Verstecke zurückziehen. Strafen führen dazu, dass unsere Katze das Vertrauen in uns verliert und sich emotional von uns abwendet.
Negative Strafe (P-)
Negative Strafe bedeutet, dass wir einen angenehmen Reiz entfernen, um ein unerwünschtes Verhalten zu unterbinden. Ein Beispiel wäre, die Katze nicht zu streicheln oder ihr Spielzeug wegzunehmen, wenn sie sich auf ein verbotenes Möbelstück setzt oder ihr das Futter zu verweigern oder wegnehmen, wenn sie z.B. nicht ihr Kunststück aufführt oder sich streicheln lassen will. Negative Strafe wird aber auch im Training eingesetzt. Sie tritt dann auf, wenn wir z.B. mit einer sog. „Schnapp-Schildkröte“ arbeiten. Damit bezeichnen wir eine Katze, die ziemlich futteraffin ist und nach unserer Hand, mit der wir Futter halten, pfötelt und gerne auch die Krallen einsetzt. Im Rahmen von Höflichkeitstraining wird die Negative Strafe gezielt eingesetzt und soll unserer Schnapp-Schildkröte-Katze dieses Pföteln durch Wegnehmen unserer Hand verleiden. Es gibt aber auch hier Alternativen, denn diese Methode ist ebenfalls nicht unproblematisch. Da die Negative Strafe nicht durch aktives Hinzufügen eines Schmerzes gekennzeichnet ist, empfinden viele Menschen das Vorenthalten oder Entfernen von etwas Angenehmen als „weniger schlimm“.
Vorteile der Negativen Strafe
Auch hier sehe ich persönlich keinen Vorteil, der die Anwendung negativer Strafe als regelmäßige Trainingsmethode ethisch rechtfertigt. Lediglich im Falle der Gefahrenverhütung fällt mir ein Grund ein, der den Einsatz Negativer Strafe sogar fordert.
- Lebensrettung: Sollte Deine Katze etwas finden, was sie unbedingt essen will oder mit dem sie unbedingt spielen will, kann die Wegnahme durchaus ihr Leben retten. Man denke an vergiftete Mäuse oder Stromkabel.
Nachteile der Negativen Strafe
Die Negative Strafe bringt Nachteile mit sich, deren Auswirkungen wir kaum abschätzen können bzw. uns selten bewusst sind. daher zähle ich an dieser Stelle einige auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
- Frust und Aggression: Eine Katze, der Futter vorenthalten wird, entwickelt relativ schnell Frust. Meist folgt, dass unsichere, aber dominantere Katzen noch eindringlicher auf ihr Futter bestehen und regelrecht übergriffig werden können.
- Selbstzweifel und Angst: Sensiblere Katzen sind ebenso unsicher, weil sie die Situation nicht verstehen, aber sie reagieren eher mit Rückzug, begünstigt durch Ängste und Misstrauen.
- Vertrauensverlust: Werden wichtige Ressourcen vorenthalten oder der Zugang von bestimmtem Verhalten abhängig gemacht, spannt dies die Beziehung zwischen Dir und Deiner Katze an und führt am Ende zu einem Verlust an Vertrauen- damit auch zu mangelnder Kooperation und unberechenbarem Verhalten.
Beispiel aus dem Alltag
Ich greife das obige Beispiel auf, in dem Deine Katze etwas findet, das gerade ihre ganze Aufmerksamkeit fesselt und gebe Dir ein analoges Beispiel, um diese Trainingsmethode besser zu verstehen.
Wenn Deine Katze Freigänger ist, kennst Du bestimmt die „Geschenke“ vor Deiner Tür oder hast schon Mal beobachtet, wie Deine Katze ihre Beute mitten vor Deinem Eingang verspeist. Warum sie genau vor Deinem Absatz ihre Maus isst, habe ich bereits in einem anderen Beitrag erklärt. Du findest ihn hier → verlinken
Stell dir vor, Du bist Gärtner und hast Dich intensiv um Deinen Garten gekümmert mit der Aussicht auf eine reiche Ernte: Du hast Dir die Hände schmutzig gemacht, Unkraut gejätet, gegrubbert, gesät, Kartoffeln gelegt und Tomaten gepflanzt und warst bei Wind und Wetter draußen, um sicherzugehen, dass mit deinem Garten alles in Ordnung ist. Du freust Dich auf Deine Ernte und kannst es kaum erwarten, sie einzuholen. Schließlich fährst Du die Ernte ein- doch in dem Moment, als Du Dir deine Belohnung- ein wohlverdientes Essen- gönnen möchtest, wird Dir alles genommen. Es ist, als ob dir jemand einen Teil Deiner selbständigen Errungenschaft und das Vertrauen, das Du in die eigene Belohnung gesetzt hast, abspricht. Du wolltest Dir Deinen Erfolg gönnen und plötzlich wird dir der Zugang zu deiner belohnten „Ressource“ verweigert.
Auf emotionaler Ebene empfindest Du das als Verlust, als eine Infragestellung Deines Rechts auf die Mühen und Leistungen, die Du investiert hast. Es ist nicht nur die Tatsache, dass Dir etwas weggenommen wird, was Du als Deine wohlverdiente Belohnung ansiehst, sondern dass Du in diesem Moment von einem „Rivalen“ in Deiner eigenen Lebenssituation konfrontiert wirst, der die Kontrolle über Deine Bedürfnisse beansprucht und Dir das Gefühl gibt, dass Deine Selbstbestimmung und die Kontrolle über Dein eigenes Leben fraglich wird. Es ist der Unterschied zwischen „ich habe es verdient“ und „ich werde übergangen“.
Gefühle Deiner Katze und Auswirkungen
Genau diese Gefühle von Ungerechtigkeit, Frustration oder Wut kann unsere Katze erleben, wenn wir ihr die Maus wegnehmen, die sie als „belohnte Ressource“ ansieht. Für sie ist es nicht einfach der Verlust eines kleinen Nagetiers, sondern der Verlust von etwas, das sie durch ihre Jagdinstinkte und ihre Selbstständigkeit „verdient“ hat. Sie sieht uns in dem Moment nicht nur als eine Quelle der Futtergabe, sondern als denjenigen, der ihre Fähigkeit, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, infrage stellt. In diesem Moment sind wir nicht nur ein „Konkurrent“, sondern jemand, der ihr die Möglichkeit, ihre eigenen Instinkte und ihre Selbstbestimmung auszuleben, aktiv verwehrt.
Es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Katzen ein tiefes Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle über ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Ressourcen haben. Wenn wir dieses Bedürfnis missachten oder in den Augen der Katze als „unfaire Konkurrenz“ erscheinen, kann es zu negativen Gefühlen und einer Verschlechterung des Vertrauens in uns kommen. Dies kann sich langfristig auf das Verhalten unserer Katze auswirken – sie könnte misstrauisch werden oder sich in gewissen Situationen zurückziehen. Der Verlust der „belohnten Ressource“ durch uns könnte für sie den Beginn einer Widersprüchlichkeit darstellen, in der sie unser Verhalten und ihre eigenen Handlungen nicht mehr in Einklang bringen kann.
Wenn wir uns dieses psychologische Zusammenspiel bewusst machen, können wir besser darauf achten, dass wir in der Interaktion mit unserer Katze respektvoll und aufmerksam handeln, ihre Instinkte und Bedürfnisse anerkennen und ihre Autonomie respektieren. Das Erlegen einer Beute ist für unser Katzen ein natürlicher Vorgang- und den müssen wir akzeptieren, wenn wir mit ihr zusammenleben wollen. Unsere Katze ist eben auch ein Jäger. Wir können ihr ihre Maus lassen. (Und das schreibe ich als Veganerin.) I.d.R. sind unsere Katzen reinliche Esser und übrig bleiben nur Magen oder seltener auch Federn im Falle von gefiederter Beute. Sobald unsere Katze sich anderen Dingen zuwendet, können wir die Überreste entfernen. Wenn unsere Katze uns sog. „Geschenke“ mitbringt, sollten wir diese ebenfalls in ihrer Abwesenheit entfernen.
Strafmethoden: Warum wir darauf verzichten
Ich setze bewusst keine Strafen im Umgang oder Training ein, da die Risiken und negativen Folgen für das Wohlbefinden meiner Katzen oder die meiner BeratungskundInnen einfach zu hoch sind und ich Strafen ethisch nicht vertrete. Strafen führen zu ernsthaften Problemen, die das Vertrauen unserer Katze in sich, ihre Umgebung oder uns stark beeinträchtigen. Sie schaffen eine Umgebung der Unsicherheit, in der unsere Katze nicht weiß, was sie tun muss, um das zu vermeiden, was sie als unangenehm empfindet. Neben Misstrauen können sich auch extreme Ängste bis zu Angststörungen sowie Aggressionsverhalten bilden.
Für eine wirksame Strafe ohne negative Folgen für unsere Katze müssten wir das perfekte „Werkzeug“, perfektes Timing, die richtige Stärke und Dauer der Strafe sowie ein absolutes Verständnis der Motivation der Katze haben – Dinge, die in der Praxis nicht zu gewährleisten sind. Es ist nahezu unmöglich, exakt zu wissen, was in dem Moment des Verhaltens im Kopf einer Katze vor sich geht. Zudem unterstellt die Strafe der Katze ein Moralverständnis. Eine Katze lebt im Hier und Jetzt. Sie hat kein Verständnis von richtig oder falsch. Dies sind moralische Begriffe. Wir Menschen entscheiden, was richtig und was falsch ist, und bewerten das Verhalten unserer Katze nach unseren menschlichen Wertvorstellungen.
Strafen basieren außerdem auf der Annahme, dass wir genau wissen, warum die Katze sich auf eine bestimmte Weise verhält, was in der Realität oft nicht der Fall ist. Daher ist es nicht nur praktisch unmöglich, sondern auch ethisch nicht vertretbar, Strafen anzuwenden.
Ich hoffe, dass ich Dir mit diesem Überblick über die Lernprinzipien ein Verständnis geben konnte über ihre Auswirkungen und die Bedeutung der Wahl der darauf basierenden Trainingsmethoden. Unser ganzes Handeln ist von Auswirkungen begleitet und manchmal ist uns nicht bewusst, was für Folgen eine Tat hat. Ich ermutige Dich, Dein Verhalten zu reflektieren, ohne in Verzweiflung zu geraten- mach Dir einfach bewusst, wie Du bisher mit Deiner Katze umgegangen bist und wie Du künftig mit ihr umgehen willst- weil Du nun ein besseres Verständnis dafür hast, welche Folgen Dein Handeln haben kann.
Es gibt ein Zitat, das ich Dir zum Schluss gerne mitgeben möchte: „Gib Dein Bestes, was Du kannst- bis Du es besser weißt. Und wenn Du es besser weißt, mach es besser.“ Maya Angelou.

Hi, ich bin Mara
Als Katzenverhaltensberaterin & Pädagogin begleite ich Dich mit Herz, Klarheit und Erfahrung dabei, Deine Katze auf Augenhöhe zu verstehen – und eine Beziehung zu gestalten, die auf Respekt und Vertrauen beruht.
Mein Augenmerk liegt besonders auf ängstlichen Katzen in Familien mit Kindern oder mehreren Katzen – gerade dort, wo der Alltag oft hektisch und herausfordernd ist.
Ich helfe Dir, Missverständnisse in Verbindung zu verwandeln – mit alltagstauglichen Schritten, die sich unkompliziert in Dein Familienleben integrieren lassen. Gemeinsam schaffen wir einen entspannten Alltag mit Nähe, Spiel und Geborgenheit.

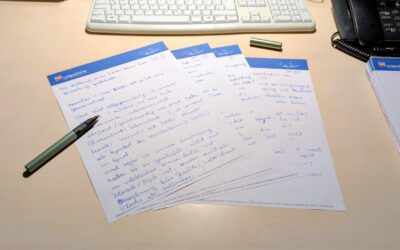

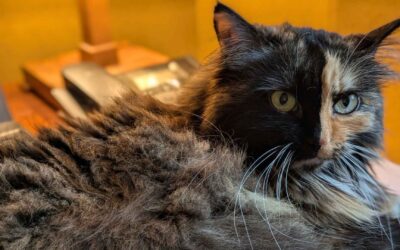

0 Kommentare